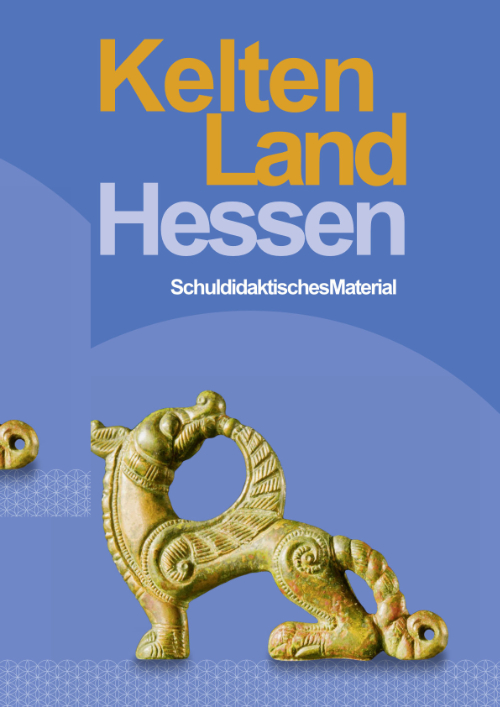Das Landesamt für Denkmalpflege Hessen nimmt Abschied von seinem ersten stellvertretenden Leiter und ehemaligen Landesarchäologen von Hessen, Dr. Fritz-Rudolf Herrmann.

Als Ausgräber des „Keltenfürsten vom Glauberg“ erlangte Herrmann Mitte der 1990er Jahre weit über die Grenzen Hessens und die Fachwissenschaft hinaus einen hohen Grad an Bekanntheit. Die eisenzeitliche Nekropole am Fuße des Glaubergs mit den darin erhaltenen aufsehenerregenden Preziosen keltischer Handwerkskunst sowie die einzigartige lebensgroße Sandsteinstatue des „Keltenfürsten“ sind heute weltweit bekannt. Es ist Herrmanns fachlicher Weitsicht zu verdanken, dass er die Entscheidung traf, die Grablege mit dem sie umgebenden Erdreich in einem Block zu bergen, um sie in Wiesbaden in der Archäologischen Restaurierungswerkstatt des Hauses unter Laborbedingungen freilegen zu lassen. Er beschritt zum damaligen Zeitpunkt Neuland in der bundesrepublikanischen Bodendenkmalpflege und schuf damit die Grundlage für das im Mai 2011 am originären Fundort in Glauburg-Glauberg eröffnete, zweite archäologische Landesmuseum Hessens, die „Keltenwelt am Glauberg“.

Herrmann wurde am 21. September 1936 in Bad Nauheim in der Wetterau geboren. Nach dem Schulabschluss studierte er Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und wurde 1962 von Günter Smolla an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. mit einer Dissertation zu den Funden der Urnenfelderkultur in Mittel- und Südhessen promoviert. Im Rahmen des Reisestipendiums der Römisch-Germanischen Kommission (RGK) des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) hielt er sich im Zeitraum 1963/64 auf dem Balkan, in Griechenland und der Türkei sowie den britischen Inseln auf. Nach Deutschland zurückgekehrt nahm er 1964 eine Referentenstelle für Provinzialrömische Archäologie im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) an, bevor ihm 1966 die Leitung der Außenstelle Nürnberg des BLfD übertragen wurde. Im Mai 1973 wechselte er nach Hessen, wo er in der Nachfolge von Helmut Schoppa zum Leiter der neu geschaffenen Dienststelle des Landesarchäologen von Hessen bestellt wurde. Mit dem Inkrafttreten des ersten hessischen Denkmalschutzgesetzes im September 1974 erfolgte zugleich die Gründung des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen (LfDH), dessen erster stellvertretender Leiter Herrmann wurde. Die von ihm geleitete Abteilung Archäologische Denkmalpflege erfuhr im Jahr 1990 eine fachlich Erweiterung und fungierte fortan als Archäologische und Paläontologische Denkmalpflege.
Wenngleich der immense Aufschwung in der bundesdeutschen Denkmalpflege im Zuge des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975 auch Hessen erfasste, blieb insbesondere der Aufbau der Archäologischen Denkmalpflege hinter dem anderer Bundesländer zurück. Diesen strukturellen Nachteil suchte Herrmann nicht zuletzt auch durch die Bindung bürgerschaftlichen Engagements an die Landesarchäologie auszugleichen. 1979 gründete er federführend die Archäologische Gesellschaft in Hessen e.V. (AGiH), die bis heute mitgliederstärkste Interessensvertretung im Bereich der Archäologischen Denkmalpflege in Hessen. In diesem Kontext steht auch der von ihm initiierte hessische Vorgeschichtstag, eine öffentliche Vortragsveranstaltung, aus welcher der heutige hessenARCHÄOLOGIE-Tag hervorgegangen ist.

Herrmann verfolgte konsequent die Vorlage wissenschaftlicher Ergebnisse der Landesarchäologie, was angesichts schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen mitunter zu jahrelangen Verzögerungen bei der Drucklegung führte. Mit den „Materialien zur Vor- und Frühgeschichte von Hessen“ begründete er eine eigenständige Monographienreihe, deren erster Band im Jahr 1976 erschien. Parallel dazu wandte er sich bewusst auch an eine nicht-fachliche Zielgruppe. Mit den seit 1977 in großer Zahl erschienenen Broschüren „Archäologische Denkmäler in Hessen“ stellte er für diese eine auf die wichtigsten Aspekte beschränkte Information zu obertägig erfahrbaren Bodendenkmälern zur Verfügung. Wesentlicher Bestandteil der Reihe war und ist eine detaillierte Anfahrtsskizze, die dazu einladen soll, das jeweilige Denkmal in der Kulturlandschaft aufzusuchen und es somit erlebbar zu machen.
Ein wichtiger Schritt hin zu einer modernen Landesarchäologie war die in den frühen 1980er Jahren von Herrmann betriebene Einrichtung der Archäologischen Restaurierungswerkstatt im Ostflügel von Schloss Biebrich. Diese wie auch seine Bereitschaft, sich neuen technischen Prospektions- und Dokumentationsverfahren zu öffnen, bildeten letztlich die Grundlage für den Erfolg der Untersuchungen auf dem Glauberg. Neben dem Glauberg wird ein weiteres archäologisches Großprojekt stets mit Herrmanns Namen verbunden sein: die Grabungen in der eisenzeitlichen Saline von Bad Nauheim. Diesen widmete er bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden aus dem aktiven Dienst im Jahr 2001 seine Aufmerksamkeit.
Für seine Verdienste um das archäologische Erbe Hessens wurde er 2008 mit der Goethe-Plakette des Landes Hessen, der höchsten Auszeichnung des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur (HMWK), ausgezeichnet. Im Alter von 87 Jahren verstarb Fritz-Rudolf Herrmann am 31. März 2024.
Prof. Dr. Udo Recker
Stellvertretender Amtsleiter
Landesarchäologe Hessen